Viele kennen die Aussage „Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert“. Gepaart mit „Behinderte bekommen doch alles“ landet man im Alltag von Menschen mit Schwerbehinderung und dem Behördenirrsinn – dem Kampf um gleichberechtigte Teilhabe und Inklusion.
Es gibt viele Menschen, die denken, dass Behinderte doch alles bekommen. Dies wird ja auch immer wieder über die Medien vermittelt. Von Umbaumaßnahmen zum Abbau von Barrieren bis hin zu lächelnden Schwerbehinderten auf Plakaten, die von (mehreren) Assistenzkräften betreut werden. Gerade zur Wahlkampfzeit oder zur Weihnachtszeit scheint dieses in vielen Menschen das Gefühl zu wecken, dass ja ganz viel für die armen behinderten Menschen getan wird.
Wir leben in einem Sozialstaat. Zum Glück. Aber als schwerbehinderter Mensch muss man ständig um die gleichberechtigte Teilhabe kämpfen. Ja, ich schreibe bewusst „muss“, denn ein Inklusions-Automatismus gibt es nicht. Anträge stellen, Widersprüche schreiben, teilweise vor Gericht ziehen — alles das, um am Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft teilnehmen zu können. Mit Teilnehmen meine ich auch nur teilnehmen, denn Inklusion, also die Möglichkeit jedes Menschen sich umfassend und gleichberechtigt an der Gesellschaft zu beteiligen, ist das noch lange nicht.
„Jeder Mensch hat Anspruch auf eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben“ lautet es dem Gesetz nach. Um dieses zu erreichen, können betroffene Personen einen Antrag bei den Rehabilitationsträger wie die Deutsche Rentenversicherung und die Agentur für Arbeit stellen. Und damit fängt das „Dilemma“ schon an. Ohne Antrag läuft erst mal gar nichts. Die Anträge sind oft mehrseitig und man muss zig verschiedene Zusatzformulare ausfüllen, eine Menge an Unterlagen erbringen.
Ich arbeite inzwischen seit über vier Jahren nicht mehr an der Universität Dortmund, sondern in einer Firma, die Software für die kommunale Verwaltung herstellt. Als ich dort angefangen habe, war das neue Gebäude gerade fertiggestellt. Zwei Etagen, mit einem Behinderten-WC, einem ebenerdigen Eingang. Aber ohne Aufzug. Weil Treppen laufen gut für die Gesundheit ist, man sich damit im Büroalltag fit hält. Weil es nur zwei Etagen sind. An Mobilitätseingeschränkte ist nicht gedacht worden – weil bis dahin einfach überhaupt kein Bedarf daran war, weder bei den Kunden noch bei den damals knapp 50 Mitarbeitern. Und dann kam ich. In mehr als 30 Jahren Firmengeschichte die erste schwerbehinderte Person, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist.
Recht schnell kam dann die Frage auf: „Warum gibt es denn hier keinen Aufzug? Du brauchst den doch wegen deiner Behinderung und das sollte doch bezahlt werden. Stell doch einfach mal nen Antrag!“
Gesagt, getan. Anträge stellen ist für mich ja inzwischen fast schon zu einem Hobby geworden. Die fast 10 Seiten Antrag ausgefüllt. Persönliche Daten, Beschreibung des Arbeitsplatzes. Eine detaillierte, mehrseitige Begründung, warum ein Aufzug notwendig ist.
Streng genommen blödsinnig, denn jeder weiß, dass man nur dann wirklich inklusiv arbeiten kann, wenn jeder alles das, was er machen möchte, auch machen kann – ohne bei anderen Personen als Bittsteller für Hilfeleistungen aufzutreten. Da reicht der Blick in den Schwerbehindertenausweis. Merkzeichen aG – außergewöhnlich gehbehindert. Treppenlaufen könnte also ein Problem sein. Oh, die Person fährt nachweislich einen E-Rollstuhl – dann ist ein Aufzug natürlich notwendig. Stempel drunter, genehmigt.
Eigentlich, denn die Realität sieht ganz anders aus. Der bürokratische Aufwand weist viele Hürden auf. Das digitale Zeitalter offenbart zwar die Möglichkeit, sich die entsprechenden Anträge online bei den Rehabilitationsträgern herunter zu laden — aber dafür muss man erst einmal wissen, welche Nummer diese haben. G0100? Oder war es G0142?
Digitales Ausfüllen der Anträge ist zwar zunächst möglich, endet aber Fragen wie „Warum ist die Maßnahme nötig?“ an der maximalen Anzahl an Zeichen, die man eingeben kann. Also doch ausdrucken, von Hand Anmerkungen machen, Zusatzblätter erstellen. Die Anträge selbst, die ja primär von Menschen mit Behinderung ausgefüllt werden, sind auch sehr komplex und im „beamtendeutsch“ gehalten. Menschen mit kognitiven Defiziten, Personen nach Schlaganfall oder nach Unfällen, sind da schon klar benachteiligt, denn ohne Fremde Hilfe schaffen die so einen Antrag erst gar nicht vollständig und korrekt auszufüllen.
Doch zurück zum Antrag. „Warum ist die beantragte Maßnahme nötig?“.
Die Erreichbarkeit des Schulungsraums im 2. OG und die Büros der Kollegen im 1. OG sind dabei offensichtliche Gründe. Aber auch ich habe eigentlich das Recht auf Small-Talk-Gespräche auf dem Flur, auf die Versorgung mit Obst und Kaffee oder auf Pausenaktionen wie Kicker oder Dart. Oder darauf, dass ich mal einfach zu einem Kollegen gehen kann und dem am PC etwas zeigen kann, ohne vorher per Teams anzufragen, ob derjenige Zeit hat und darum zu bitten, dass er doch dann runter in mein Büro kommt. Oder auf gemeinsames Kuchenessen bei einem Geburtstag oder oder… kurz: ich habe das Recht auf Inklusion!
Ausführlich alltägliche Situationen beschrieben. Ein Architekt wurde beauftragt, eine Kostenschätzung für das Projekt zu erstellen. Als alle Unterlagen vollständig waren, ging der Antrag dann auf den Postweg zur Deutschen Rentenversicherung (DRV).
Um einen Nachweis zu haben, dass der Antrag eingereicht wurde, empfiehlt sich das per Einschreiben mit Rückschein. Denn eine Eingangsbestätigung von Unterlagen bekommt man heute nicht mehr. Meine Erfahrung der letzten Jahre ist, dass immer wieder normale Briefe auf dem Postweg verschwinden. Zum Glück gibt es zumindest bei der DRV auch ein digitales Postfach, was personenbezogen und nur nach Scannen des Personalausweises bedient werden kann – aber auch da verschwinden seltsamerweise Unterlagen, obwohl diese im Postfach bei den gesendeten Nachrichten angezeigt werden!
Ich glaube, ich schweife ein wenig ab… sorry. Wenige Wochen nach Eingang des Antrags bei der DRV bekomme ich einen Anruf vom technischen Berater. Dieser hat die Aufgabe zu prüfen, ob die Maßnahme wirtschaftlich ist oder ob es kostengünstigere Alternativen gibt. Dies hängt natürlich auch von den Gegebenheiten vor Ort ab, so dass ein Termin in der Firma unumgänglich ist. Gesagt getan, ein Termin wurde vereinbart. Während des Termins hatte der Technische Berater auch einige Ideen: man könnte ja die Einzelbüros im EG zu einem Seminarraum zusammenfassen. Das würde zwar die Seminarraum-Situation lösen, aber die Erreichbarkeit meiner Arbeitskollegen, die dann entweder im 1. oder im 2. OG sitzen, wäre weiterhin nicht gegeben. Also wurde – zum Glück – diese Idee verworfen.
Anstelle eines Lifteinbaus schlägt dann der technische Berater vor, dass man doch heute alles per Telefon, Teams oder Zoom machen kann – ein Umbau wäre dann nicht notwendig. Dass dieses schon aufgrund meiner Schwerhörigkeit annähernd unzumutbar ist, will er zunächst nicht einsehen – ich könnte ja so Vis-a-Vis mit ihm kommunizieren. Ja, das kann ich – aber bei Teams und Co hängt es auch einfach von der Tonqualität ab, ob ich mein Gegenüber verstehe. Ja, auch hier bei Kommunix gibt es Personen, die ich aufgrund der Stimmlage, der Artikulationsart oder aufgrund von Akzenten nur schlecht verstehe.
Lange Rede, kurzer Sinn: nach über einem Jahr Bearbeitungszeit seitens der DRV stellte sich heraus, dass dem Gutachter die Kostenaufstellung des Architekten nicht genügt. Also wurde eine neue Kostenaufstellung erstellt, die viel detaillierter war – und aktuelle Preise beinhaltete.
Mitte 2025. Mal wieder Post von der DRV. Diesmal aber nicht die Bitte erneut irgendwelche Unterlagen einzureichen, sondern eine Kostenzusage: die DRV fördert den Einbau eines Aufzugs mit maximal 25%, wobei die 25% auf den ersten eingereichten Kostenvoranschlag beziehen. Warum die DRV diesen als Kostengrundlage genommen haben und warum die Fördersumme 25% beträgt, steht in dem zweiseitigen Brief der DRV zur Kostenübernahme nicht. Daher habe ich, auch um einen Widerspruch zu formulieren, die Unterlagen angefordert.
Wäre das nicht bittere Realität, könnte man echt lachen. Die Begründung der Förderhöhe ist wie folgt: ich habe einen 20h Arbeitsvertrag und nach eigener Aussage bei dem Besichtigungstermin vor Ort hätten wir gesagt, dass ich erwartungsgemäß ca. 5 Wochenarbeitsstunden im Schulungsraum verbringen würde. Das entspräche 5/20 und damit 25%, woraufhin nur 25% der Kosten übernommen werden sollten.
Die Begründung der Förderhöhe ist schon echt ein Brüller. Wenn ich für den Urlaub also einen Hundebuggy kaufe, dann sage ich dem Verkäufer, dass ich ja nur 2/52 des Preises zahlen werde, weil ich den Buggy ja nur die 2 Wochen im Jahr für den Urlaub brauche. Warum habe ich nur das Gefühl, dass der Verkäufer der Idee nicht zustimmen wird?
Zurück zum Antrag. Natürlich akzeptiere ich diese Entscheidung so nicht, sondern habe direkt und in Absprache mit der Geschäftsführung Widerspruch gegen die Förderhöhe eingelegt. 2 Jahre sind nun seit Antragstellung vergangen. 2 Jahre, in denen ich nichts anderes möchte als das, was für meine Kolleginnen und Kollegen so selbstverständlich ist. Einfach am Arbeitsleben vollumfänglich teilhaben. Mir einen Kaffee oder Tee holen, wenn ich dazu Lust habe. Mit meiner Kollegin in der Küche auf ihren Geburtstag anstoßen und im kleinen Kreis gemeinsam einen Muffin essen. Mit den Kollegen die Kundenschulung durchführen — denn Barrierefreiheit wird immer mehr nachgefragt und in den Ausschreibungen verlangt!
Nach einem Arbeitstag komme ich nach Hause. Eine Mail teilt mir mit, dass die Deutsche Rentenversicherung eine Nachricht in meinem elektronischen Postfach für mich hat. Mit pochendem Herzen hole ich meinen Personalausweis raus, authentifiziere mich und öffne das Online-Postfach der DRV. Ich frage mich im Stillen, was die Sachbearbeitung jetzt wieder für Unterlagen einfordert, welche offenen Fragen noch vorhanden sind.
Ich lese das Schreiben zweimal, dreimal. Ich schicke eine Mail an die DRV, ob ich das Schreiben richtig verstanden habe.
Es ist nun amtlich. Der Aufzug kann gebaut werden. Die DRV beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Kosten für den Einbau der Aufzugsanlage. Die Zuschusshöhe entspricht dem Kostenvoranschlag des Architekten. Nach mehr als 2 Jahren, vielen Schreiben hin- und her endlich die Kostenübernahme. Bis der Aufzug gebaut ist, wird es noch dauern — aber endlich kann ich von Inklusion am Arbeitsplatz träumen und weiß, dass dieser Traum Realität werden wird.
Ich erinnere mich an das Gespräch mit der Geschäftsleitung vor mehr als 2 Jahren, als wir beschlossen hatten, den Antrag auf Kostenübernahme für den Aufzug zu stellen. Ich wurde sinngemäß gefragt: „wie lange rechnest du denn, dass die brauchen?“ Als ich antwortete, dass ich mit ca. einem Jahr rechne, wurde ich mit großen Augen angeschaut. „Nein, das ist doch eine Behörde, so langsam arbeiten die doch nicht! Das geht doch bestimmt schneller“. Heute lächle ich und denke gerade „Es tut mir leid, dass ich dich so eines Besseren belehren musste.“
Aber: der Behördenirrsinn lässt – zumindest für mich – nicht nach. Nach über 13 Jahren ist für mich ein neues Auto fällig. Da ich (leider) nicht einen kleinen Smart oder Polo fahren kann, sondern behinderungsbedingt einen Bus und zudem noch verschiedene Umbauten benötige, geht es für mich direkt wieder weiter: Anträge herunterladen und ausfüllen, Kostenvoranschläge von Autohäusern und dem Auto-Umbauer besorgen, Begründungen schreiben usw. Seit gut zwei Wochen arbeite ich schon daran und hoffe, den Antrag dann am Wochenende losschicken zu können. Dann heißt es wieder: warten und hoffen. Wenn ihr also ein paar Daumen zum Drücken für mich habt, dann freue ich mich sehr – denn die kann ich immer gebrauchen 😊

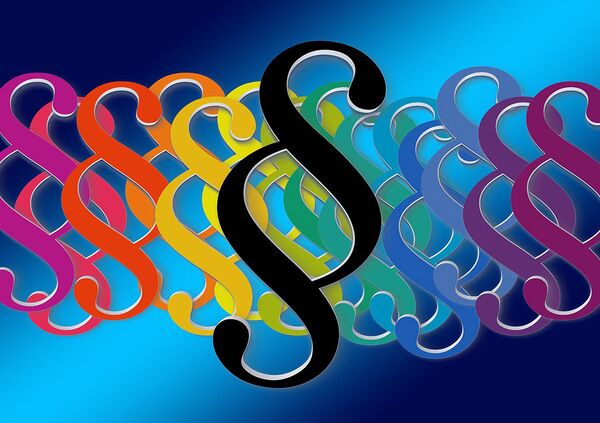
Schreibe einen Kommentar